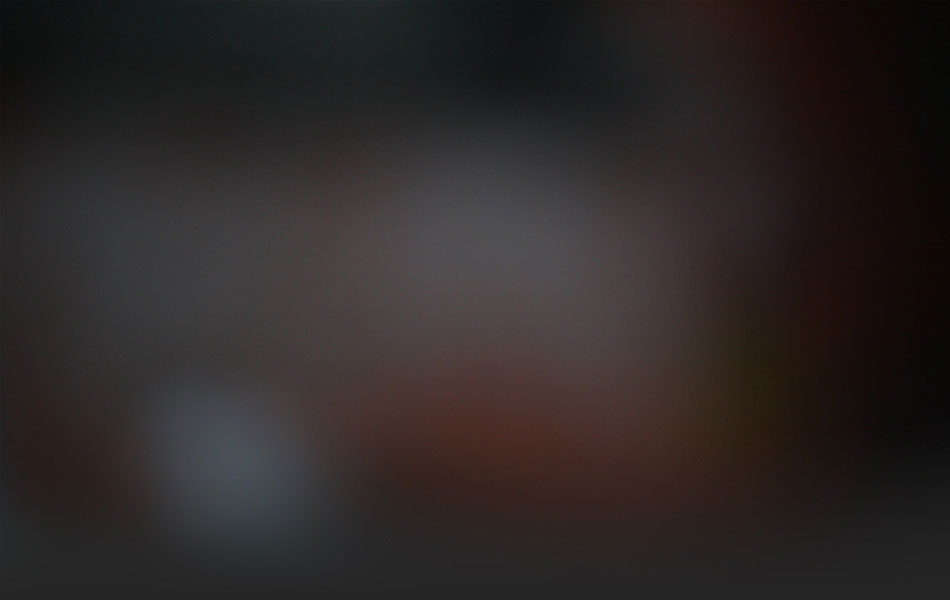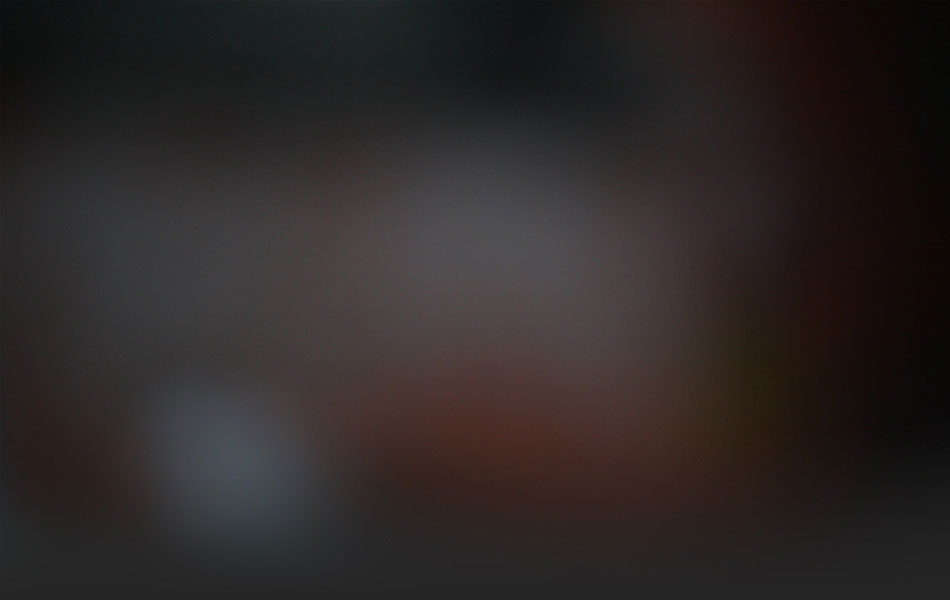Sonntag, der 2. August 1914
* Erste Kriegshandlungen * Die deutsche Lüge vom Kriegsbeginn durch Russland * Französische Bomber über Nürnberg und andere „Tatarenmeldungen“ * Der deutsche Einmarsch in Luxemburg * Das Ultimatum an Belgien * Mobilmachung in Deutschland *
In der Nacht gibt es erste kleinere Angriffe russischer Truppen gegen Bahnhöfe, Postämter und Fernsprechleitungen an der Grenze zu Ostpreußen. Die deutsche Regierung spricht der Öffentlichkeit gegenüber von heimtückischen Überfällen. Dass sie dem Zarenreich zuvor bereits den Krieg erklärt hat, verschweigt sie. Zur Untermauerung dieser Täuschung veröffentlicht sie den Telegrammwechsel zwischen Kaiser und Zaren, der belegen soll, wie „Willy“ unverdrossen vermittelte, während „Nicky“ rüstete. Diese Korrespondenz schließt mit einem Appell Wilhelms II., er sei bereit zu weiteren Vermittlungen, wenn alle russischen Rüstungen eingestellt werden und die Grenzen unverletzt bleiben. Dieses Telegramm ist erst am 1. August um 22:45 in Deutschland abgegangen, also fast sechs Stunden nach der deutschen Kriegserklärung. Zar Nikolaus war davon so irritiert, dass er Botschafter Pourtalès um 4 Uhr morgens aus dem Bett holen ließ, um eine Erklärung zu bekommen. Doch davon ahnt die deutsche Öffentlichkeit nichts. Sie glaubt, dass dieser Friedensappell ihres Kaisers umgehend mit russischen Feindseligkeiten beantwortet wurde, denen nicht einmal eine Kriegserklärung voraus ging. Bis zum frühen Abend werden 20 Mann Verlust auf russischer Seite und einige deutsche Leichtverwundete gemeldet. Mit Begeisterung registriert man, dass es dem Kreuzer Augsburg um 21 Uhr gelingt, den russischen Kriegshafen Libau in Brand zu schießen.
Auch sonst steht der Tag – ein überaus prächtiger Sommertag – ganz im Zeichen des Kriegsbeginns. Um zehn Uhr morgens treffen sich der Kaiser, Bethmann Hollweg, Moltke, Tirpitz und Generaladjutant Plessen zur Lagebesprechung. Der Kanzler meint noch immer, man müsse auch Frankreich den Krieg erklären, um von Belgien den Durchmarsch für die deutschen Truppen fordern zu können. Moltke hält das nach wie vor für überflüssig. Er führt Gerüchte an, die Franzosen hätten in Metz einen Brunnen mit Cholera-Bakterien vergiftet und versucht, einen Tunnel der Moselbahn zu sprengen. Damit wäre der Krieg faktisch ausgebrochen und man könne ohne weiteres handeln. Überhaupt, so beklagt sich Moltke beim Kaiser, wolle die Regierung absolut nicht einsehen, dass man sich bereits im Krieg befinde, sondern glaube scheinbar immer noch, die ungeheure Lawine mit einer Note stoppen zu können. Tirpitz pflichtet ihm bei.
Die Brunnenvergiftung und der Anschlag auf die Bahn sind nicht die einzigen Gerüchte über französische Übergriffe, die an diesem Tag aufkommen. So sollen auch 80 französische Offiziere in preußischen Uniformen versucht haben, die niederländisch-deutsche Grenze zu überschreiten. Dazu aber hätten sie vorher die belgische und niederländische Neutralität verletzten müssen. Auch wird gemeldet, dass französische Truppen bereits einige Ortschaften im Elsass besetzt hätten sowie mehrere französische Ärzte beim Vergiften von Brunnen ertappt und sofort standrechtlich erschossen worden seien. Bei Wesel wurde angeblich ein französisches Kriegsflugzeug beim Versuch abgeschossen, die Eisenbahnlinien zu zerstören.
Für besondere Erregung sorgt die Meldung, dass französische Kriegsflugzeuge am Vormittag Bomben über Nürnberg abgeworfen haben sollen. Einige Zeitungen drucken am Nachmittag Extrablätter. Wie es zu der Meldung kommen konnte, ist unklar. Vermutlich haben Landsturmleute, die nahe Nürnberg die Eisenbahnlinien bewachten, ein Flugzeug gesehen, das sie für eine feindliche Maschine hielten. Die Meldung wurde dann ohne Prüfung bis zum Generalstab weitergeleitet. Vom Militär gelangte sie an die Presse. Außerdem wurde sie offiziell von der Regierung nach England und Italien weitergegeben. Am Abend telegraphiert der preußische Gesandte in Bayern jedoch an Kanzler Bethmann Hollweg, dass es dafür keinerlei Bestätigung gäbe.
Auch von den anderen Gerüchten wird keines je verifiziert. Die meisten stellen sich später als definitiv falsch heraus. Sogar in internen Aufzeichnungen des Auswärtigen Amtes wird am 3. August von „Tatarenmeldungen“ gesprochen. Trotzdem werden sie von den Nachrichtenagenturen als „amtlich bestätigte Meldungen“ verbreitet
Während die deutsche Regierung so nach dem angeblichen Überfall Russlands auch einen durch Frankreich erfindet, besetzt das deutsche Militär seit sieben Uhr morgens Luxemburg. Dem luxemburgischen Regierungspräsidenten Paul Eyschen (1841–1915) teilt Jagow mit, man sei leider zu dieser Maßnahme gezwungen, um die von Deutschland betriebenen Eisenbahnen zu schützen. Eine vorherige Verständigung sei nicht möglich gewesen, da man zuverlässige Nachrichten von einem französischen Vormarsch gehabt habe – eine glatte Lüge – und deswegen gezwungen gewesen sei, schnell zu handeln.
In London ist die Empörung über den Einmarsch in Luxemburg groß. Großbritannien garantiert – wie auch die anderen Großmächte – seit 1867 die Neutralität des Landes. Auch Deutschlands Dreibundpartner Italien hat sich bereits abgewandt und nimmt mit der Entente Verhandlungen über die Bedingungen für einen Kriegseintritt auf ihrer Seite auf. Dagegen schließ das Osmanische Reich ein Bündnis mit Deutschland. Der deutsche Generalstab fordert die Regierung auf, auch auf Bündnisse mit der Schweiz und Schweden hinzuarbeiten. Außerdem müsse man die Haltung von Rumänien, Bulgarien und Griechenland feststellen. Ein weiterer Bündnispartner könne Persien werden, das das russische Joch abschütteln wolle. In Indien, Ägypten und Südafrika will der Generalstab entweder Aufstände gegen die Briten provozieren, zuvor aber versuchen, Großbritannien durch das Versprechen, dort maßvoll vorzugehen, doch noch zur Neutralität zu bewegen. Japan soll aufgefordert werden, die günstige Gelegenheit zu nützen im Fernen Osten „sämtliche Aspirationen [Bestrebungen]“ auf Kosten Russlands zu verwirklichen.
Obwohl der Krieg bereits begonnen hat, geht das diplomatische Gezerre weiter. Der britische Botschafter Goschen erklärt in Berlin, wenn Österreich gegen Russland demobilisiere, könne ein Weltkrieg noch verhindert werden. Außenamts-Mitarbeiter Zimmermann nennt das „kindisch“ und hält dagegen, nur eine allgemeine russische Demobilisierung könne eventuell noch etwas ändern. Der britische Premier Asquith frühstückt mit Lichnowsky und erklärt dem völlig aufgelösten und sogar weinenden Botschafter, Deutschland könne eine britische Intervention noch verhindern, wenn es die belgische Neutralität achte und mit seiner Flotte nicht die französische Küste angreife. Denn laut britisch-französischer Marinekonvention ist die gesamte französische Flotte im Mittelmeer stationiert. Dafür garantiert Großbritannien den Schutz der französischen Nord- und Atlantikküste.
Um 20 Uhr übergibt dann der deutsche Gesandte in Brüssel Claus von Below (1866–1939) das lange vorbereitete Ultimatum an Belgien, mit dem das Land aufgefordert wird, den Durchzug der deutschen Truppen zu dulden. Komme Belgien dem nach, werde man nach Kriegsende seine Integrität wieder herstellen, falls nicht, werde man es als Kriegsgegner betrachten. Als Begründung müssen die längst widerlegten französischen Flieger herhalten. Da Frankreich den Krieg begonnen habe, sei man gezwungen zu handeln, wird argumentiert. Auf Betreiben von Generalstabschef Moltke beträgt die Zeit für eine Antwort nur 12 Stunden.
Aus St. Petersburg berichtet der britische Botschafter George Buchanan (1854–1924), das russische Volk stehe inzwischen hinter der Regierung. Sogar die sozialistischen Arbeiter hätten eine Streikruhe verkündet. Eine Ansprache des Zaren im Winterpalais hätte einen Sturm des Patriotismus entfacht und auch vor der britischen Botschaft hätte sich zwischen 23 und 24 Uhr eine ungeheure Menge versammelt, die die russische Nationalhymne sang und daneben England kräftig hoch leben ließ.
Und das deutsche Volk? Am späten Vormittag um halb zwölf Uhr findet am Bismarckdenkmal vor dem Reichstagsgebäude ein Kriegsgottesdienst unter freiem Himmel statt, an dem Tausende teilnehmen. Hofprediger Döbring beschwört den „Geist Bismarcks“ und klagt an: „Wir fragen die Nachbarn im Osten und Westen: ‚Warum ließet ihr uns nicht in Frieden, warum ließet ihr uns nicht genießen, was wir erworben haben? Wenn Ihr uns aber reizt, wenn Ihr uns, die wir nicht habgierig sind, etwas nehmen wollt, so verteidigen wir jedes Flecken Erde bis zuletzt.“ Die Kreuzzeitung schreibt dazu: „Der vaterländische Geist der Berliner ist herrlich! Dass man das erleben darf – dafür wird man Gott aus tiefem Herzen danken, was auch die Zukunft bringen mag. Das Vaterunser vor dem Denkmal Bismarcks, das 30.000 Menschen zusammen laut beteten, ist vielleicht das tiefste gewesen, was Berlin bis jetzt erlebt hat. Den alten Veteranen, die dabei standen, im Schmucke ihrer Kriegsauszeichnungen, liefen die Tränen herab, und vielen Männern und Jünglingen ebenfalls. … Und bei alldem die ruhige, feste Zuversicht, mit der man dem schweren Kriege entgegensieht. Bei solchem Geiste muss man sich fragen, ist das ein Krieg …? Nein, ‚ein Kreuzzug ist’s, ein heil’ger Krieg‘:“
Und die Vossische Zeitung: „Dem wachsamen Beobachter kann eine leise Veränderung nicht entgehen, die Sonnabend und Sonntag im Berliner Straßenbilde unterscheidet. Über Nacht hat die Stimmung der Massen keinen Umschwung erfahren, aber sie hat sich auch zu einem anderen Ausdruck vertieft. Der letzte Rest des Gezwungenen ist abgestreift, der Lärm als Selbstzweck kommt auch in seinem schwächsten Anklange nicht mehr zur Geltung. Auch der erste Kriegsrausch der Jugend ist vorbei. Die Massen, die sich heute am Bismarck-Denkmal zum Gottesdienst, im Lustgarten bei der Wachmusik drängten, sind aus Rausch und Trubel erwacht. Ein tiefer Ernst war über die Menge gebreitet, ein Ernst, frei von Zagen und Bangen, aber getragen von einem Bewusstsein der Stunde, beschwingt von einem sicheren Gefühl der Zuversicht. Als die alten Soldatenlieder und Choräle ihr Brausen anhuben, drängten sich vielen im Kreise ringsum Tränen ins Auge, Tränen, derer sich Frauen und Männer nicht zu schämen brauchten. Stiller als tags zuvor ging es vor den Schlössern des Kaisers und des Kronprinzen zu. Aber im Schweigen der Masse, wenn Singen und Vivatruf verstummten, sprach die rechte Stimmung des Kriegs, die bei einem Volke von altem Waffenruhm gleich frei von Kleinmut wie von Übermut bleiben muss. Ungeheuer ist die Fülle von Menschen, die nach wie vor durch die Straßen des Zentrums zieht. Die Straßenbahnen können nur langsam durch den dichten Strom sich ihren Weg bahnen, wo ein Helm, eine Uniform sichtbar wird, wird sie bald laut, bald leise, mit Dank und Zuversicht begrüßt.“
Voller Kriegseuphorie ist auch der bayerische Militärattaché Wenninger, der diese jedoch lieber für sich auf einem Morgenritt im Grunewald genießt: „Sonntag!“, notiert er anschließend in sein Tagebuch. „An einem Sonntag beginnt die schwerste Blutarbeit, die je die Welt gesehen hat. Ein leuchtender Sonntag! … Still und leer ist’s im Grunewald und feierlich wie in einer Kirche. Auf dem Heimritt begegne ich den Sonntagsreitern … auf prächtigen Pferden. Mit echter Schadenfreude sehe ich sie heute an. … Wartet nur, morgen zieht man Euch die schönen Tiere unterm Hintern weg!“
Wirklich tauchen noch am selben Tag an den Litfasssäulen Aufforderungen auf, alle Pferde zu den Aushebungsstellen der Armee zu bringen. Das bunte Bekanntmachungswirrwarr an den Säulen schildert der Berliner Lokalanzeiger anschaulich: „Weiße und rote Zettel rufen die Passanten, zwingen sie, näher zu treten. Mit weithin leuchtender Überschrift wird auf den Anschlägen die Mobilisierung bekannt gemacht. Daneben gelbe Zettel, die den Einberufenen die von der Eisenbahn bereitgestellten Sonderzüge mitteilen. … Und dann ist auf den Säulen auf zwei Plakaten von der Aushebung der Pferde für die Armee die Rede. Neben Zetteln, die in zartem Weiß erklärend und verordnend über den verhängten Kriegszustand Auskunft geben, berichten Plakate der königlichen Verwaltung der Armee-Konserven-Fabrik, dass für den gesteigerten Betrieb Arbeitskräfte zu hohem Lohne gesucht werden …Wichtiger ist aber das auf derselben Bekanntmachung angegebene Kaufgesuch der Militärbehörde für gutes Dauerfleisch.“
Überall folgen die ersten Soldaten ihrem Gestellungsbefehl, finden sich in den Kasernen, aber auch provisorischen Quartieren wie Schulen ein, wo sie in Feldgrau eingekleidet und ausgerüstet werden und dann durch die Straßen zu den Bahnhöfen marschieren. „Dann kleine Trupps Reservisten, dort ein Fähnlein Dragoner, hier eine Abteilung Artillerie, hier ein Zug Infanterie“, schildert das Berliner Tageblatt. „Und auf allen Gesichtern der gleich unbestimmte Ausdruck hoffnungsfroher Zuversicht. Und überall Jubel und Zuruf den scheidenden Männern … Hier ein Soldat mit seinem weinenden Mädel im Arm. Doch da gibt es kein Spötteln und Witzeln. Es ist, als ob die Menge andächtig sei. In Andacht versunken, vor der unwägbaren, unfassbaren Flut der Geschehnisse. Eine auf Feldgrau gestimmte Symphonie aller Farben. Dazwischen vereinzelte Marineangehörige, dem Lehrter Bahnhof zustrebend. Es ist ein Bild bemerkenswerten Ausgleichs: Ein Bursche bringt seinen Leutnant zur Bahn. Der Leutnant legt ihm die Hand auf die Schulter und gibt ihm hastig noch ein paar gute Lehren. Dann ein langer, herzlicher, kräftiger Händedruck. Der Krieg bringt die Menschen näher und wenn er auch nicht die nötigen Grenzen verwischt, so sieht doch jeder den anderen zuerst als Mensch.“
„Eine gewaltige Arbeitslast bringt der erste Mobilmachungstag den Bahnhöfen“, berichtet dieVossische Zeitung. „Von allen Seiten sieht man die Wagen und Autos heranfahren, und das Gepäck ist zu Bergen aufgeschichtet, die sich kaum vermindern wollen. Wer zu Fuß auf den Bahnsteig will, muss sich erst durch die endlosen Reihen der Wagen, die nebeneinander aufgefahren sind, hindurch winden. Man sieht, dass die Nachricht vom Ausbruch des Kriegs alle Berliner, die voller Zuversicht bis zum letzten Tage in der Sommerfrische weilten, jetzt wieder nach Hause lockt. Von der See und aus den Bergen kommen sie gebräunt zurück, die meisten wohl nur zum kurzen Aufenthalt, denn in kurzer Zeit müssen sie dem Ruf des Vaterlandes Folge leisten. Alle durchzittert eine gewisse Nervosität, die aber den großen Ereignissen der Tage gegenüber nicht zum Ausbruch kommt. ... Darunter mischen sich die, die zu ihrem Truppenteil wollen und auf der Durchreise Berlin berühren. Man erkennt sie leicht, denn auf ihren Gesichtern lagert ruhiger Ernst und harte Entschlossenheit. … Der Reserveoffizier mit dem hellen Koffer und der Landwehrmann, der in Pappkartons seine Habseligkeiten mitnimmt, sie sind alle von gleichen Empfindungen, von gleichem Mut beseelt, und die Hochachtung derer, die noch daheim bleiben, grüßt sie schweigend mit verständnisvollem Blick. Vor den Fahrplänen, den Schaltern und den amtlichen Bekanntmachungen drängen sich die Scharen und doch wartet jeder ruhig bis er an ihn die Reihe kommt. Dieselbe musterhafte Ordnung, die wir in allen den letzten Tagen bei den Kundgebungen Unter den Linden und vor dem Schlosse bewundert haben, zeigt sich auch hier.“
Der Berichterstatter des Berliner Tageblatts dagegen legt sein Augenmerk auf persönliche Dramen. „Mit den Zurückbleibenden spielen sich jene bitteren Szenen ab, die die junge Generation nur vom Hörensagen oder aus den Kriegsschilderungen von anno dazumal kannte. Hier konnte von Unbeteiligten nicht mehr die Rede sein, wer das miterlebt hat, dem ging es durch Mark und Bein. Es lässt sich nicht schildern, wie viel Tränen da flossen, wie viel Herzen von herbem Weh zerrissen, ihre laute Klage zum Himmel sandten. Niemand braucht sich ja auch in dieser schicksalsschweren Abschiedstunde seiner Gefühle zu schämen, so gaben sich Männer und Frauen schrankenlos ihrem verzweifeltem Schmerze hin. Mancher riss sich mit rascher Bewegung kurzerhand von seinen Lieben los und stürzte stumm davon, um die Qualen nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Hier läuft ein altes Mütterchen verzweifelt die endlose Wagenreihe entlang, sie sucht den Sohn, um ihn in letztes Mal ans Herz zu drücken, dort sitzen ein paar einfache Frauen zusammen, hocken auf einem Gepäckhaufen, sie rühren sich trotz der tröstenden Zurede der Beamten nicht von der Stelle. Ein Vater rafft sich zusammen und herzt noch ein letztes Mal mit dem kleinen, blondlockigen Buben, der ganz verängstigt auf all das Getriebe um sich schaut. Aus der Sperre wankt ganz außer sich ein junges Mädchen, und laut heult es auf. ‚Ich hab ihn nicht mehr gesehen, der Zug war schon weg.’ Die Wartesäle gleichen einem Feldlager, wie in einem Bienenhaus schwirrt alles durcheinander. Die Unterschiede der Klassen gibt es hier ebenso wenig mehr wie in den Zügen. Die Offiziere nehmen im Wartesaal 3. und 4. Klasse rasch noch eine Stärkung und Landarbeiter ohne Kragen machen es sich auf den Samtpolstern der 1. Klasse bequem. Die Offiziere tragen einen tiefernsten Gesichtsausdruck zur Schau ... Die Mannschaften dagegen versuchen zum Teil noch einen etwas erzwungenen Humor zu zeigen, und manches echte Berliner Scherzwort tönt noch aus den dicht besetzten Fenstern der überfüllten Waggons. Dann, als die Abfahrt sich immer weiter verzögert, werden ungeduldige Rufe laut. Ein Offizier wird angerufen. ‚Sie Herr Leutnant, nu sorgen Sie doch bitte dafür, dass wir mal losfahren, wir wollen die Kerls verdreschen, dass sie sich’s merken sollen. Die Hunde werden wir schon klein kriegen’. Und freundlich erwidert der Offizier: ‚Na, nur Ruhe Jungens, es geht gleich los, morgen kriegt ihr den bunten Rock und dann könnt ihr ja zeigen, was deutsche Hiebe sind.’“
Der Zabern-Skandal und aller Ärger über das Militär sind vergessen: „Lange, nach mancher Leute Meinung fast zu lange, war der deutsche Soldat nur noch Exerzierobjekt und Paradestück“, schreibt der Berliner Lokalanzeiger. „Mit einem Mal ist er wieder Träger und Verfechter eines unserer höchsten Volksgenossenschaftsideale. Des vaterländischen Bewusstseins, der Vaterlandsliebe. Wo heute ein Offizier, ein Unteroffizier, ein Mann in Waffen sich zeigt – er war der Mittelpunkt des Interesses. Ihm selbst merkte man unzweideutig an, wie – um wieder einen Ausspruch des Großen von Marbach [Schiller] anzusprechen – der Mensch mit seinem größeren Zwecke wächst. Wie sein Körper sich strafft, wie seine Augen leuchten. Und nicht anders ist’s bei den zahlreichen jugendlichen Gestalten, die zwar noch in Zivil stecken, denen man aber den Einberufenen, den Krieger von morgen sofort ansieht.“
Die Berichte der verschiedenen Blätter ähneln sich: Überall ein Mix aus Sentimentalität, patriotischer Stimmungsmache und Kraftmeierei. Nur der Ausschlag in die eine oder andere Richtung ist unterschiedlich. Aber die Geschichte vom „armen Mütterlein“, dessen „Einziger“ auch gegen die Russen will, (das aber den Beschreibungen nach eher ein Großmütterlein sein müsste,) darf genauso wenig fehlen wie die Braut, die tapfer ihre Tränen unterdrückt, die Scherze der „echten Jungen“ oder Beweise für die plötzliche Verbundenheit zwischen den Klassen. Und nahezu unisono beteuert man, wie echt, wie ehrlich die Stimmung der Leute sei, erfüllt von tiefsten und heiligsten Gefühlen.
Auch ganz andere Quellen schildern den Rausch des „Augusterlebnisses“. So schreibt der Schriftsteller Kurt Tucholsky (1890–1935) zehn Jahre später: „Ein Deutscher, der vor dem Kriege in Frankreich ansässig war und im August 1914 die Grenze überquerte, hat mir geschildert, wie die Kriegsstimmung jenseits und diesseits des Rheins aussah. ‚Sie besinnen sich’, sagte er, ‚auf diese merkwürdig heißen, drückend schwülen Julitage. Die Luft lastete, Staub wirbelte allerorten auf, ohne dass das erlösende Gewitter kam. Es war, als ob einer den Atem anhielte. Dann grollte es. Durch Frankreich ging ein stummer Schrei. Keiner wollte es glauben.’ Die Leute hätten sich wie erstarrt angesehen, fuhr er fort – es kann ja nicht sein, es kann nicht sein, stand in den Gesichtern. Totenstill ging eine Nation ans Sterben. Dies war der Eindruck der allerersten Tage. Es ist selbstverständlich, dass, als der Apparat einsetzte, Spionenhetze, Tobsuchtsanfälle und Staatskoller genau so ausbrachen wie bei uns. Aber die Franzosen sagen das heute! Solange das Volk sprach, der kleine Mann, der einzelne, solange die große Kollektivität noch nicht richtig funktionierte – so lange sprach die Stimme der Menschlichkeit. Und dann kam der Erzähler über den Rhein. ‚Mir blieb der Verstand stehen. Ich glaubte, ich sei auf ein Schützenfest geraten. Glockenläuten, Girlanden, Freibier, Juhu und Hurra – ein großer Rummelplatz war meine Heimat, und von dem Krieg, in den sie da ging, hatte sie nicht die leiseste Vorstellung.’ Krieg ist, wenn die andern sterben. Helden – es waren nicht einmal Helden in dem Augenblick. Es waren die armen und rohen Geneppten einer Bauernkirchweih. Und dann ging es los.“
Derartige Berichte haben zu der weit verbreiteten Meinung geführt, „alle Deutschen“ wären begeistert und jubelnd in den Ersten Weltkrieg gezogen. Abgesehen davon, dass es patriotische Kundgebungen und Ovationen für die einrückenden Soldaten auch in den Ländern der Entente gab – wenn auch nicht im selben Umfang – bestand auch Deutschland nicht nur aus Unter den Linden und Anhalter Bahnhof. Zahlreiche Forscher haben sich die Mühe gemacht – meist für ein regional begrenztes Gebiet –, alle verfügbaren Dokumente von Zeitungsberichten über Fotos bis hin zu Privatbriefen genauer unter die Lupe zu nehmen und dabei auch ganz andere Stimmungen gefunden: Verzweiflung, Wut, Kritik etc. Aber natürlich drängten sich die Verzweifelten bei den Kundgebungen nicht in die erste Reihe. Natürlich berichten die Zeitungen eher über die offensichtlichen Demonstrationen als über versteckte Gefühle, natürlich fallen – auch auf den Fotos – die Winkenden und Hüte Schwenkenden mehr auf als jene, die sich still verhalten. Es gibt auch die Tendenz, dass Menschen ihre Meinung umso stärker zurückhalten, je mehr sie das Gefühl haben, damit in der Minderheit zu sein. Auf diese Weise greift die – vielleicht nur vermeintliche – Mehrheitsmeinung immer stärker um sich greift, während die Position der (vermeintlichen) Minderheit ganz untergeht. So jedenfalls lautet die Theorie der „Schweigespirale“ der Kommunikationswissenschaftlerin Elisabeth Noelle-Neumann (1916–2010). Aber selbst aus Berlin gibt es Berichte, dass am 1. und 2. August 1914 abseits der Kundgebungen rund um das Schloss eine eher ernste, gedrückte Stimmung herrschte. Der belgische Botschafter Eugène Baron Beyens (1855–1934) etwa befand nach einem nachmittäglichem Spaziergang über den Kurfürstendamm, dass „im Unterschied zu 1870“ keine Kriegsbegeisterung herrsche. Auch in anderen deutschen Städten scheint trotz zahlreicher patriotischer Kundgebungen die ernste Stimmung überwogen zu haben. So berichten die linksliberalen Hamburger Nachrichten: „Im allgemeinen verhielt sich die Menge … ruhig und dem Ernst der Zeit angemessen. Nur wo ein Trupp Reservisten … vorüber kam, bildete man Spalier und begleitete den Zug mit Hurra-Rufen.“ Und auch die zitierten Berliner Zeitungen schildern ja Tränen, Verzweiflung und Ernst, auch wenn sie versuchen, alles in ihr Gemälde von den „hehren Gefühlen des deutschen Volkes in der Schicksalsstunde“ hineinzupressen.
Man sollte auch nicht den Fehler begehen, die Massenversammlungen in den deutschen Städten nur unter dem Schlagwort „Kriegbegeisterung“ abzutun. In erster Linie trieb das Bedürfnis nach Informationen die Menschen in die Innenstädte. Dort erfuhr man durch öffentliche Verkündigungen, Anschläge an den Post- und Telegraphenämtern, Extrablätter und Gerüchte alle Neuigkeiten am schnellsten. Bis all das in die Vorstädte und Dörfer gelangte, konnte viel Zeit vergehen. Dass diese Massenzusammenrottungen an wenigen zentralen Plätzen dann ihre ganz eigene Dynamik entfalteten, sollte im Zeitalter von Public Viewing nicht ganz unverständlich sein. Wenn Menschen schon das Bedürfnis haben, ein Spiel ihrer Nationalmannschaft zusammen zu erleben und ihre Emotionen zu teilen, um wie viel mehr ist eine Sehnsucht nach Gemeinschaft dann angesichts eines drohenden Krieges zu erwarten. Zu einem Gutteil waren die Kundgebungen und Demonstrationszüge in den Innenstädten – vor allem direkt nach dem Ultimatum – auch ein „Event“, das man, wenn man schon nicht dabei war, zumindest gesehen haben musste. Sogar die Kinos zeigten damals eilig zusammen geschnittene Filme von den Kundgebungen im ganzen Reich, so dass man im bequemen Sessel sich und anderen nochmals beim Jubeln zusehen konnte.
Als sich die Krise dann zuspitzte, dürfte ein Gutteil der Gesänge vor dem Berliner Schloss und anderswo auch ein Singen gegen die Angst gewesen sein. Gerade die nächtlichen Zusammenrottungen vor den Palästen von König, Kronprinz und Reichskanzler am 31. Juli und 1. August hatten für viele wohl auch Zufluchtscharakter. So als könne man die leitenden Männer, die man zuvor so ausgiebig kritisiert hat, durch ausgiebiges Zujubeln und viele „brausende“ Hochs zu wahrhaften Stützen des Reiches aufbauen. Wie irrational das Ganze war, zeigt sich daran, dass bereits jede kleine Bewegung hinter den Gardinen wie ein Hoffnungszeichen begrüßt wurde.
Unbestreitbar aber ist die riesengroße Bereitschaft der deutschen Bevölkerung, sich – nachdem der Krieg nun mal Tatsache geworden ist – daran zu beteiligen und persönlich für einen guten Ausgang einzusetzen. Hunderttausende, meist junge Nichtwehrpflichtige melden sich freiwillig zu den Waffen. Frauen, Mädchen und Untaugliche reißen sich darum, beim Roten Kreuz und anderswo Hilfsdienste zu leisten. Die eingezogenen Soldaten werden bereits als künftige Helden gefeiert, auf ihrem Marsch durch die Städte begleitet, mit Blumen, Zigaretten und anderem beschenkt und auf den Bahnhöfen von Frauenkomitees an langen Tafeln noch einmal verpflegt. Selbst Theodor Wolff schwärmt während der ersten Kriegsmonate in seinem Tagebuch – während er gleichzeitig schwer mit der Regierung ins Gericht geht – von der „prachtvollen Opferstimmung des deutschen Volkes“, das „besseres verdiene.“
Vermutlich aber erwartet ein Großteil der Menschen einen Krieg wie 1870/71: Kurz und am Ende siegreich. „Unsere angeborene und gesunde Volkskraft, deren Seele schon in den letzten Tagen so herrlich gesprochen hat, wird aller Welt beweisen, dass die Deutschen von heute noch dieselben wie von 1870 sind“, droht etwa die rechtsradikale Deutsche Tageszeitung. Weder Presse noch Bevölkerung haben wirklich auf der Rechnung, wie sehr sich die technisch-strategischen Rahmenbedingungen eines Krieges seitdem verändert haben.
Die deutsche Regierung dagegen stellt der französischen um 19 Uhr ihr Ultimatum, das Paris auffordert, innerhalb von 18 Stunden zu erklären, wie es sich im Falle eines deutsch russischen Krieges zu verhalten gedenke. Niemand erwartet, dass die Franzosen sich für eine neutrale Haltung entscheiden. Sollte dies aber wider Erwarten doch geschehen, so hat Botschafter Schoen die geheime Anweisung, die Festungen Toul und Verdun als Pfänder zu fordern. Auf diese Weise will die deutsche Führung verhindern, dass Frankreich zwar anfangs neutral bleibt, aber später in den russisch-deutschen Krieg eingreift und so den Schlieffen-Plan sabotiert.
Ungeschickterweise spricht Schoen, nachdem er Außenminister Viviani das Ultimatum übergeben hat, bereits über die Modalitäten seiner Abreise und lässt Präsident Poincaré seine Grüße ausrichten. Für Viviani ist das ein eindeutiges Zeichen, dass Deutschland den Krieg will, „obgleich zwischen Frankreich und Deutschland kein direkter Konflikt besteht und obgleich wir seit Beginn der Krisis alle Anstrengungen zur Erzielung einer friedlichen Lösung gemacht haben und noch machen.“
Um 21 Uhr deutscher Zeit – in St. Petersburg ist es bereits Mitternacht – übergibt Botschafter Pourtalès das Ultimatum an Russland. Es fordert die Einstellung der russischen Mobilmachung innerhalb von 12 Stunden – und zwar der gesamten, auch der gegen Österreich-Ungarn. Passiert das nicht, werde man auch in Deutschland mobil machen. Im ursprünglichen Entwurf stand noch: „Die Mobilmachung bedeutet unvermeidlich Krieg.“ Doch diesen Satz hat man vor der Übergabe gestrichen.