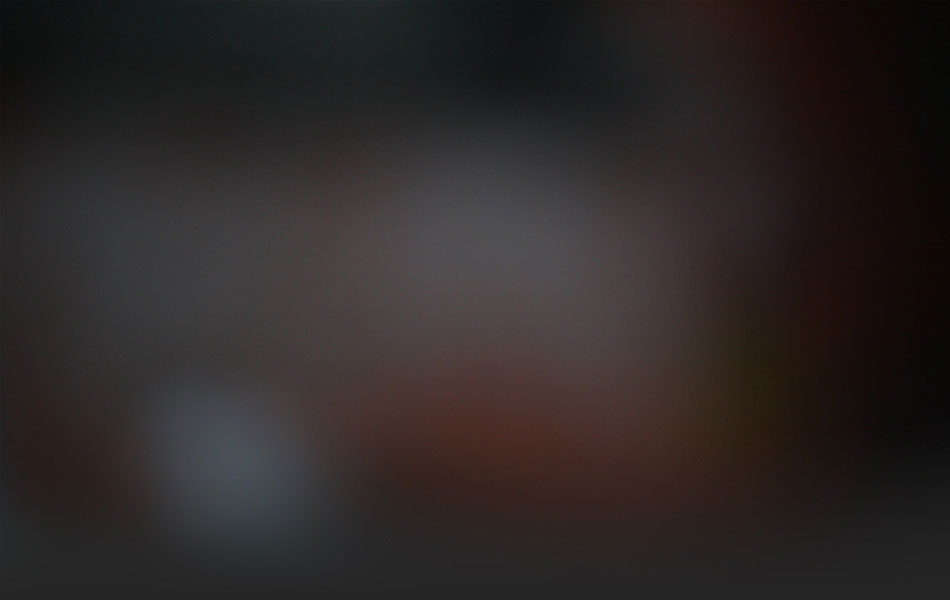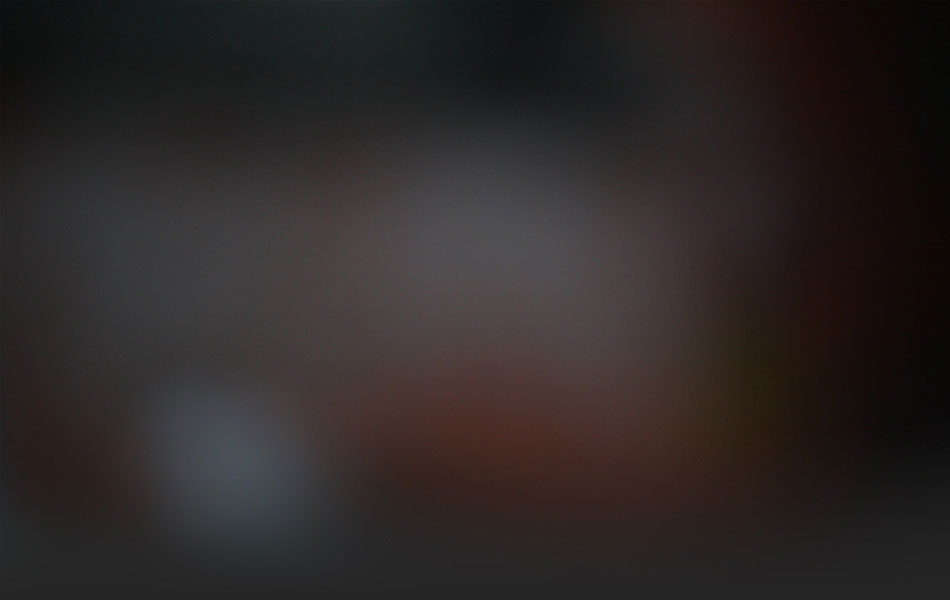Montag, der 27. Juli 1914
* Die Rückkehr von Wilhelm II. * Das Verhältnis von Kaiser und Zar * Der Druck der ausländischen Botschafter * Der Umgang mit der serbischen Antwort * Die Reaktionen im deutschen Südwesten *
+ + + Buch kaufen + + +
Die kaiserliche Jacht erreicht in den Morgenstunden Kiel. Majestät sind entspannt. Auf seiner Rückreise aus Norwegen ist Wilhelm II. wieder mal zu der Überzeugung gelangt – wie, bleibt sein Geheimnis – dass Russland in den österreichisch-serbischen Konflikt nicht eingreifen wird. Also erklärt der Kaiser, er werde noch am Abend nach Schloss Wilhelmshöhe bei Kassel weiterfahren und dort wie gewohnt mit der Kaiserin den zweiten Teil seines Urlaubs verbringen. Doch kaum betritt er deutschen Boden und erhält die neuesten Nachrichten, wird ihm klar, dass an weiteren Urlaub nicht zu denken ist. Prompt sendet er wilde Befehle an verschiedene Führungskräfte der Marine, die bei den Empfängern für Kopfschütteln sorgen. Dann fährt er mit seinem Sonderzug nach Potsdam. Bethmann Hollweg hat ihn gebeten, nicht nach Berlin zu kommen. Sein Auftauchen könne dort Kundgebungen mit antirussischer Prägung provozieren. Das aber könne man nicht brauchen, da Russland ins Unrecht gesetzt werden müsse. Der Kaiser folgt dieser Bitte, ist aber sauer und schimpft: „Das wird immer toller, jetzt schreibt mir der Mann sogar vor, dass ich mich meinem Volke nicht zeigen darf!“ Kaiserin Auguste Victoria (1858–1921) verlässt noch am selben Tag Wilhelmshöhe und kehrt ebenfalls nach Potsdam zurück.
Am Bahnhof Potsdam-Wildpark wird der Kaiser kurz nach 15 Uhr von Bethmann Hollweg, Moltke und Tirpitz empfangen, die ihn über die jüngsten Entwicklungen informieren. Bethmann Hollweg behauptet, England werde mit ziemlicher Sicherheit neutral bleiben. Während der Historiker Fritz Fischer in den 1960-er Jahren davon ausging, dass die deutsche Regierung zu diesem Zeitpunkt tatsächlich an die englische Neutralität glaubte, meint der britische Wilhelm-Biograf John C. G. Röhl (geb. 1938), die Regierung habe den Monarchen mit manipulierten Abschriften der Telegramme aus England bewusst in Sicherheit gewiegt, um kaiserliche Panikreaktionen zu verhindern.
Zu Röhls Ansicht passt, dass Bethmann Hollweg bei dieser Begegnung die akute Kriegsgefahr generell tief hängt. Er behauptet, Frankreich habe keine besondere Lust mitzutun. Vor allem aber müsse Russland in die Rolle des Provozierenden gedrängt werden. Wenn das Zarenreich sich so ins Unrecht setze, solle man einen Krieg nicht scheuen. Eine Ausbreitung des Konfliktes sei aber noch nicht wahrscheinlich.
Für Wilhelm II. hat er ein Telegramm entwerfen lassen, das Zar Nikolaus II. hinsichtlich der österreichischen Pläne beruhigen soll. Doch der Kaiser will es nicht versenden. Wahrscheinlich ist er dem Zaren gram, dass dieser keinerlei „monarchische Solidarität“ mit Österreich übt. Am nächsten Tag jedenfalls kommentiert Wilhelm II. einen russischen Zeitungsartikel, in dem es heißt, dem deutschen Kaiser sei bekannt, dass Russland Serbien mit seiner ganzen militärischen Macht unterstützen werde, mit den Worten: „Nein, das war mir nicht bekannt! Ich konnte nicht voraussetzen, dass der Zar sich auf seiten von Banditen und Königsmördern stellen würde.“
Wilhelm II. und Nikolaus II. betrachten sich als „sehr aufrichtig ergebene Freunde und Vettern.“ Blutsverwandt sind sie zwar nur weitläufig, aber Zarin Alexandra (1872–1918) ist eines der vielen Enkelkinder von Queen Victoria und somit eine Cousine des Kaisers. 1905 haben die beiden Monarchen in Björkö (Primorsk/Russland) sogar mal ein Bündnis zwischen ihren Ländern beschlossen, das aber von keiner der beiden Regierungen akzeptiert wurde. Ihr Verhältnis ist allerdings starken Schwankungen unterworfen. Wilhelm II. tendiert dazu, den neun Jahre jüngeren Zaren zu verachten und ihm Schwäche und Unentschlossenheit vorzuwerfen. Nun kam man Nikolaus II. tatsächlich als trübe Tasse betrachten. Andererseits hat der deutsche Kaiser nicht das geringste Verständnis für die russischen Interessen und die innenpolitischen Rücksichten, die Nikolaus nehmen muss. Wenn „Nicky“ nicht tut, was nach „Willys“ Meinung richtig wäre, können aus Sicht des Kaisers nur die Charakterfehler des Zaren Schuld sein.
Unterdessen erklärt Außenamts-Chef Jagow dem österreichischen Botschafter Szögyény-Marich, man werde in nächster Zeit Vermittlungsvorschläge aus England an die österreichische Regierung weiterleiten müssen, identifiziere sich aber keineswegs damit, sondern sei sogar entschieden gegen deren Berücksichtigung. Man wolle nur verhindern, „dass England im jetzigen Moment … gemeinsame Sache mit Russland und Frankreich mache.“
Die deutschen Botschafter werden angewiesen darauf zu beharren, dass Deutschland nur zwischen Russland und Österreich, nicht aber zwischen Österreich und Serbien vermitteln könne. Der österreichisch-serbische Zwist gehe keinen Dritten etwas an.
Trotzdem sieht sich Jagow dem Druck der ausländischen Botschafter ausgesetzt. Der englische Vertreter Edward Goschen (1847–1924), ein deutschstämmiger Brite, hat sogar eilends seinen Urlaub abgebrochen. Nun berichtet er nach London, Jagow wirke krank und müde, sei aber optimistisch, weil er glaube, Russland sei nicht in der Lage, Krieg zu führen. Goschens französischer Kollege Jules Cambon dagegen geht hart mit Jagow ins Gericht. „Wenn Blut vergossen werden sollte, so werden Sie persönlich dafür verantwortlich sein“, erklärt er dem deutschen Außenamts-Chef unverblümt. Dann will er mit ihm über die serbische Antwort sprechen, aber Jagow behauptet, er habe noch keine Zeit gehabt sie zu lesen. Der Franzose beschwört ihn: „Wenn Sie die serbische Antwort lesen werden, wägen Sie, ich bitte Sie im Namen der Menschlichkeit, deren Punkte mit Ihrem Gewissen ab und beladen Sie sich nicht selbst mit einem Teil der Verantwortung für die Katastrophe, deren Vorbereitung Sie zulassen.“ In Wahrheit liegt die serbische Antwort im deutschen Außenamt immer noch nicht vor. Erst nach dem Gespräch mit Cambon beauftragt Jagow seinen Botschafter Tschirschky in Wien, eine Kopie zu beschaffen. Doch die Serben sind schneller. Am Nachmittag bringt ihr Berliner Gesandter in Berlin, Milutin Jovanović, ein Exemplar in der Wilhelmstraße vorbei. Die Österreicher versorgen Tschirschky dagegen erst um 23:30 in der Nacht mit einer Kopie. Ihr Büro sei überbürdet, da die Antwort so umfangreich sei, lautet die Entschuldigung. Zu diesem Zeitpunkt hat die k.u.k.-Führung den Text der serbischen Antwort aber schon an die Presse weitergeleitet. Zusammen mit einem ausführlichen Kommentar, der Punkt für Punkt die Diskrepanzen zwischen österreichischer Forderung und serbischer Antwort aufführt. Auf diese Weise will das auswärtige Amt zeigen, dass Serbien dem Verlangten jeweils nicht wortgetreu, sondern „vom Geiste der Unaufrichtigkeit erfüllt“ nachgekommen sei. Dieses Dokument, das wahrscheinlich an der „Überlastung“ schuld gewesen ist, wird auch an die österreichischen Botschafter gesandt, die damit die jeweiligen Regierungen überzeugen sollen, dass Serbien nur zum Schein, aber nicht wirklich Entgegenkommen gezeigt habe.
Anderswo hat man sich die serbische Antwort schneller zu beschaffen gewusst als in der Wilhelmstraße. In Paris etwa erklärt Interims-Regierungschef Bienvenu-Martin dem österreichischen Botschafter Szécsen, niemand verstehe, warum es wegen unbedeutender, übrig gebliebener Differenzen zum Bruch mit Serbien gekommen sei. Österreich-Ungarn werde furchtbare Verantwortung auf sich laden, wenn es deswegen einen Weltkrieg hervorrufe. Szécsen erwidert, zum Krieg komme es nur durch die Einmischung Dritter. Seiner Regierung meldet er aber: „Die weitgehende Nachgiebigkeit Serbiens, die hier für unmöglich gehalten wurde, hat starken Eindruck gemacht. Angesichts unserer Haltung verbreitete sich Ansicht, dass wir Krieg um jeden Preis wollen.“
Ganz ähnlich sind die Töne aus London. Der deutsche Botschafter Lichnowsky schreibt, Grey sei zum ersten Mal verstimmt. Serbien sei den österreichischen Forderungen in einem Umfang entgegen gekommen, den man niemals für möglich gehalten habe, was wohl nur auf russischen Druck zurückzuführen sei. Begnüge sich Österreich nicht mit dieser Antwort und beginne gar, das wehrlos daliegende Belgrad zu besetzen, dann sei vollkommen klar, dass Österreich Serbien erdrücken und über Serbien den russischen Einfluss auf dem Balkan treffen wolle. Es sei nun an Deutschland, seinen Einfluss in Wien geltend zu machen, damit Österreich die Antwort akzeptiere oder zumindest zur Grundlage von Verhandlungen mache. Wieder fügt Lichnowsky seinem Bericht einen dringenden persönlichen Appell an. Er sagt, er stehe dafür ein, dass eine erfolgreiche Bewältigung der Krise beste Beziehungen zu England garantiere. Ein Scheitern aber führe zu einem Weltkrieg, in dem England auf jedem Fall auf der Seite von Frankreich und Russland stehen werde.
In umgekehrter Richtung melden die französischen und englischen Botschafter in Wien und Berlin in ihre Heimatländer, dass sie angesichts der deutschen-österreichischen Blockadehaltung kaum noch Hoffnung auf eine friedliche Lösung des Konflikts sehen.
Trotzdem drängt Grey gegenüber dem österreichischen Botschafter Mensdorff nochmals auf eine Vermittler-Konferenz. Er weist auch seinen Berlin-Botschafter Goschen an, ein offizielles Ersuchen an das Auswärtige Amt zu stellen, dass Lichnowsky zusammen mit dem französischen Botschafter Paul Cambon, dem Italiener Guglielmo Imperiali (1858–1944) und Grey selber Vermittlungsvorschläge ausarbeiten darf.
Eine andere Idee bringt der russische Außenminister Sasonow ins Spiel. Er schlägt vor, dass die Belgrader Gesandten der Großmächte künftig gemeinsam als Garanten gegen eine weitere antiösterreichische Agitation wirken. Aus taktischen Gründen will er aber nicht selber in die Offensive gehen, sondern bittet Grey darum.
Angesichts dieser regen Vermittlertätigkeit beginnt es dem deutschen Kanzler Bethmann Hollweg zu dämmern, dass eine weitere strikte Blockadehaltung nicht mehr ratsam ist. Er schreibt Botschafter Tschirschky nach Wien, man könne die englischen Vermittlungsvorschläge nicht mehr pauschal ablehnen, sonst stehe man als Kriegstreiber da. „Das aber würde unsere eigene Stellung im Lande unmöglich machen, wo wir als die zum Kriege Gezwungenen dastehen müssen.“ Man müsse deshalb den englischen Vorschlag „dem Wiener Kabinett zur Erwägung unterbreiten. … Erbitte Graf Berchtolds Ansicht über die englische Anregung, ebenso wie über Wunsch Herrn Sasonows, mit Wien direkt zu verhandeln.“
Besagter Berthold holt sich unterdessen bei Kaiser Franz Joseph die Erlaubnis, schon morgen den Krieg erklären zu dürfen, um sich Vermittlungsversuchen seitens der Entente zu entziehen. Außerdem habe es schon erste Geplänkel gegeben, berichtet er dem Kaiser. Serbische Truppen hätten von Donaudampfern aus bei Temes-Kubin auf k.u.k.-Truppen geschossen; ein Gerücht, das sich später als falsch heraus stellt.
Auch der preußische Kriegsminister Falkenhayn trifft Maßnahmen. Er lässt Weizen aufkaufen, ordnet den Schutz der Bahnanlagen an und sagt die vorgesehenen Übungen verschiedener Truppenteile ab.
In der Presse werden unterdessen Gerüchte gehandelt, denn in den Redaktionen liegt die serbische Antwort auch noch nicht vor. Glaubt man allerdings einem Bericht des russischen Botschaftsangehörigen Bronewski, dann hat die serbische Gesandtschaft in Berlin versucht, den wichtigsten Berliner Zeitungen den Text der Antwort zukommen lassen. Diese aber hätten ihn unter verschiedensten Vorwänden nicht abdrucken wollen. Andererseits zitieren viele Blätter Auszüge aus der Antwort, die bereits in der französischen Presse erschienen sind. Dass Serbien nur einen Punkt abgelehnt haben soll, stimmt hoffnungsfroh, ebenso die englische Bereitschaft zu vermitteln. Eifrig nachgedruckt wird auch eine Meldung der britischen Nachrichtenagentur Reuters, die meldet, auch Russland sei zur Vermittlung bereit. Doch auch ein möglicher Krieg ist bereits Thema. Italien soll angeblich seine Bündnistreue zugesagt haben, während sich Bulgarien, die Türkei und Griechenland schon für neutral erklärt hätten. Kriegsvorbereitungen gibt es angeblich in Russland, England, Frankreich, Belgien, Italien, Montenegro und natürlich auch Deutschland. Belgrad soll bereits besetzt worden sein. Auch über Stärke und mutmaßliche Pläne der einzelnen Heere wird spekuliert.
In der konservativen Kreuzzeitung weist man – ganz auf Regierungslinie – Vermittlungsversuche zurück. Von Deutschland zu verlangen, Österreich in den Arm zu fallen, sei eine Zumutung. Da „alle Welt“ Österreich das Recht auf Genugtuung zugestehe, sei jede Einmischung ein Zeichen, dass der Betreffende auf Krieg aus sei. Auch Kölnische Zeitung und Münchner Neueste Nachrichten geben die Parole aus, Druck auf Österreich könne die Situation nur verschärfen. Selbst Theodor Wolffs Berliner Tageblatt argumentiert, wer versuche Österreich zur Umkehr zu zwingen, zwinge Deutschland zur Erklärung seiner Bündnispflicht. Die rechte Deutsche Tageszeitung meint dagegen, dank der energischen deutschen Haltung scheine sich die Situation zu entspannen. Russland und Frankreich sähen wohl ihre militärische Ohnmacht ein. Die Kommentatoren der Frankfurter Zeitung schreiben, ein europäischer Krieg würde so furchtbar werden, dass wohl keine Macht die Verantwortung auf sich nehme, ihn auszulösen. Mittel und Wege, den Krieg zu verhindern, gäbe es sicher, allerdings sei es ehrgeizigen und unzulänglichen Diplomaten vorbehalten, sie zu finden.
Aus Frankreich berichtet der deutsche Botschafter Schoen, der erste Schock über das Ultimatum sei abgeklungen – u. a. hatte es dramatische Kursverluste an den Börsen gegeben. Inzwischen wären Presse und Geschäftswelt etwas hoffnungsvoller und beschuldigten Deutschland nicht mehr der Kriegstreiberei. Aber man sei der Ansicht, die Entscheidung über Krieg und Frieden liege jetzt wesentlich in Berlin. Wenn Deutschland in Wien und Frankreich in St. Petersburg mäßigend wirke, könne der Frieden erhalten bleiben.
Botschafter Pourtalès berichtet aus St. Petersburg: „Börse stark beunruhigt, sonst öffentliche Meinung nicht besonders erregt, die Presse gemäßigt, Streikagitation im Gange.“
In Deutschland gehen die pro-österreichischen Demonstrationen weiter. In Köln und Hamburg klagt die örtliche Presse über lautstarke Randale. Bethmann Hollwegs Mitarbeiter Riezler dagegen, der mit dem Kanzler nach Berlin zurückkommt und dort die Menschenmassen Unter den Linden erlebt, notiert in seinem Tagebuch. „Die Menschen sind noch nicht völlig erwacht aus dem Traum des Friedens, der ihnen doch eine Selbstverständlichkeit scheint, noch ungläubig und neugierig.“ Zuerst hätten er und der Kanzler geglaubt, es handele sich nur um halbwüchsige Burschen, die eine Gelegenheit zum Radau suchten. „Es werden aber mehr und mehr und die Töne werden echter. … Ein ungeheurer, wenn auch wirrer Betätigungsdrang im Volke, eine Gier nach großer Bewegung, aufzustehen für eine große Sache, seine Tüchtigkeiten zu zeigen.“
Auch in Wien gibt es wieder nächtliche Kundgebungen. Dabei wird neben patriotischen österreichischen und deutschen Liedern auch die italienische Hymne Marcia Reale gesungen. Der österreichische Ministerpräsident Stürgkh vertraut dem deutschen Botschafter Tschirschky an, dass er dies veranlasst habe, um den Bündnisgenossen bei der Stange zu halten.
Aus Karlsruhe dagegen meldet der preußische Gesandte Karl von Eisendecher (1841–1934): Ein paar „radaulustige Leute“ hätten vor den Zeitungsredaktionen und Kaffeehäusern Die Wacht am Rhein und Deutschland über alles gesungen. Provokative, antirussische Straßendemonstrationen wie in Mannheim hätte es jedoch nicht gegeben und die Großherzoglich Badische Regierung würde sie auch verhindern. Fast die gesamte Presse und die öffentliche Meinung fänden, man müsse Österreich gegebenenfalls beistehen, aber ehrliche Begeisterung für einen Krieg bestehe nicht.
Im Elsass ist die Stimmung gespalten. Als im Kino von Mühlhausen über den Projektionsapparat der Abbruch der Beziehungen zwischen Österreich-Ungarn und Serbien bekannt gegeben wird, klatschen einige junge Besucher spontan Beifall. Sie werden jedoch prompt von der Mehrheit niedergeschrien, die „A bas la guerre!“ (Nieder mit dem Krieg) skandiert.
Es gibt aber auch jene, die bereits in Panik verfallen und angstvoll die Banken stürmen, um ihre Ersparnisse in Sicherheit zu bringen. Allein in Berlin werden an diesem Tag 935.000 Mark von den Konten der Städtischen Sparkassen abgehoben.
Auch in Belgrad wappnet man sich. Überall werden weiße Flaggen gehisst, die nach internationalen Vereinbarungen die im Krieg geschützten Gebäude markieren.
Fortsetzung folgt am 28. Juli 2014
Copyright: Christa Pöppelmann, Verlinkung gerne, Weiterverbreitung (auch auszugsweise) nur mit Genehmigung des Verlages.