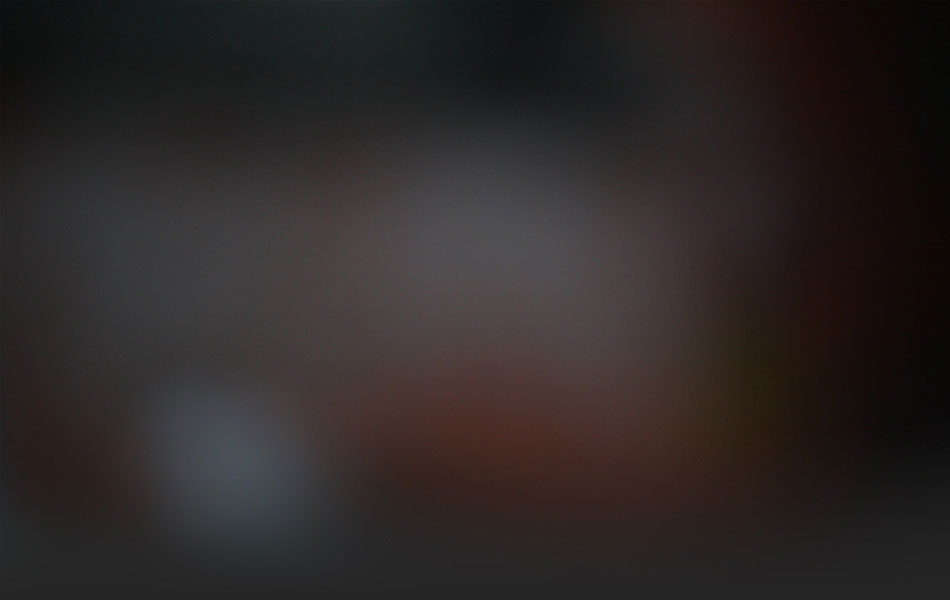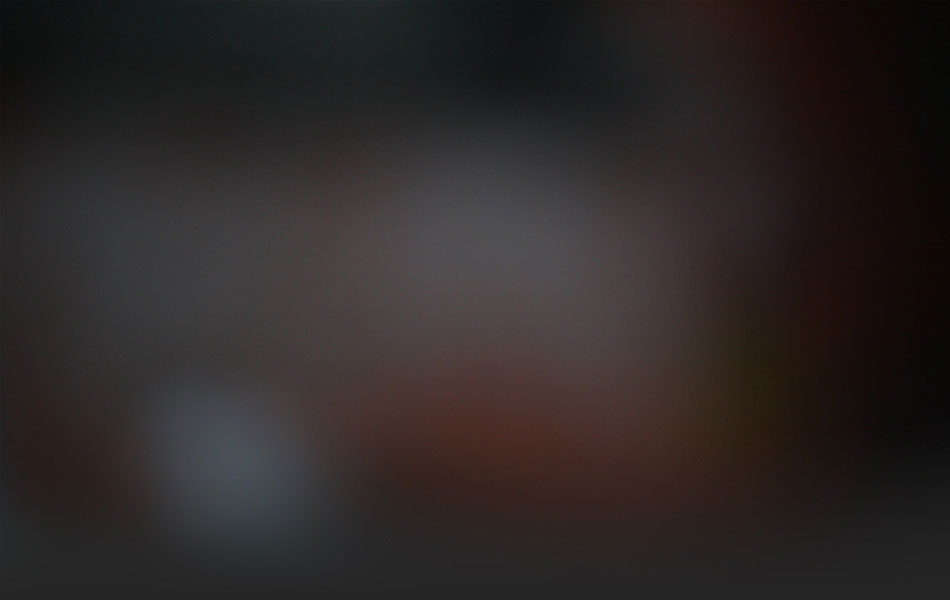Mittwoch, der 15. Juli 1914
* Verschiebung des Ultimatums * Diskussion über Italien *
In Berlin findet eine Konferenz zur finanziellen Vorbereitung des Krieges statt. Neben Kanzler Bethmann Hollweg, Jagow und Delbrück nehmen Finanz-Staatssekretär Hermann Kühn (1851–1937) und der Präsident der Reichsbank, Rudolf Havenstein (1857–1923), teil.
In Österreich haben Kriegsminister Krobatin und Generalstabschef Conrad von Hötzendorf ihren Urlaub angetreten. Der russische Wien-Botschafter Nikolai Schebeko findet das sehr beruhigend: „Alles lässt darauf schließen, dass die streng geheim geführte Untersuchung in Sachen der Ermordung des Erzherzogs Franz Ferdinand und seiner Gemahlin nichts zutage gefördert hat, was einen Zusammenstoß zwischen Österreich-Ungarn und Serbien hervorrufen könnte“, berichtet er seiner Regierung.
Auch die Deutsche Tageszeitung bezweifelt angesichts dieser Ferienreisen, dass es eine ernste, kriegerische Aktion gegen Serbien geben wird. Das rechte Kampfblatt ist aber enttäuscht und spricht von einem Rückzug.
Doch ein solcher ist nicht geplant. K.u.k.-Außenminister Berchtold will mit der Übergabe des Ultimatums lediglich warten, bis der französische Staatsbesuch in Russland beendet ist, bei dem „der friedliebende, zurückhaltende Kaiser Nikolaus und der immerhin vorsichtige Herr Sasonow dem unmittelbaren Einflusse der beiden Hetzer Iswolski und Poincaré ausgesetzt wären.“ Der genannte Iswolski ist der ehemalige russische Außenminister, der 1908 in der bosnischen Annexionskrise durch dubiose Absprachen und antisemitische Ausfälle auffällig geworden war. Absprachen übrigens, an denen Berchtold damals als k.u.k-Botschafter in St. Petersburg und Gastgeber des entscheidenden Treffens direkt beteiligt war. Das Ganze kostete Iswolski seinen Job. Seitdem ist er nur noch Botschafter in Paris und erst recht ein erbitterter Feind Österreichs.
Berchtold ist jedoch auch klar, dass das Abwarten Risiken birgt. „Wir müssen momentan einerseits ein Abflauen der unserer Politik günstigen öffentlichen Meinung … verhindern“, lässt er seinem Kollegen Jagow mitteilen, „andererseits nicht durch eine die Situation systematisch zuspitzende Sprache unserer Presse bei anderen Mächten etwa einen Mediationsgedanken aufkommen lassen.“
Jagow erwidert, er verstehe den Grund für die Verzögerung, bedauere sie aber außerordentlich, da er auch in der deutschen Öffentlichkeit ein Abflauen der „sympathischen Zustimmung“ für Österreich befürchte. Er macht sich zudem Sorgen um die Zustimmung in Italien. Dessen Verhältnis zu Dreibund-Partner Österreich-Ungarn ist bereits seit langem schlecht. Es geht dabei vor allem um Albanien und „unerlöste“ italienische Gebiete im Habsburgerreich. Jagow hat nun Angst, dass sich Italien im Falle eines österreichisch-serbischen Krieges verbal auf die Seite der Serben schlägt, was wiederum Russland zu einer aggressiven Haltung ermutigen könne. Er drängt deshalb Österreich, sich mit dem Bündnispartner zu verständigen, auch wenn es dafür Kompensationen wie das Trentino anbieten müsse.
Der deutsche Außenamts-Chef ahnt nicht, wie zerrüttet das Verhältnis zwischen Wien und Rom bereits ist. So hat Italien 1902 ein geheimes Abkommen mit Frankreich geschlossen, während auf der anderen Seite k.u.k.-Generalstabschef Conrad von Hötzendorf Kriegspläne gegen den Bündnispartner in der Schublade liegen hat.
Wien ist auch fest entschlossen, seine Pläne gegen Serbien vor Italien geheim zu halten. Allerdings reden einige Angehörige der deutschen Botschaft in Rom darüber. Der italienische Außenminister Antonino di San Giuliano (1852–1914) telegraphiert daraufhin seinen Botschaftern in Russland und Rumänien. Sie sollen die dortigen Regierungen dazu bewegen, drohend gegenüber Wien und Berlin aufzutreten, um einen ernsten Schritt gegen Serbien zu verhindern. Anweisungen, von denen Österreich umgehend erfährt, weil es den Chiffriercode der italienischen Regierung geknackt hat.