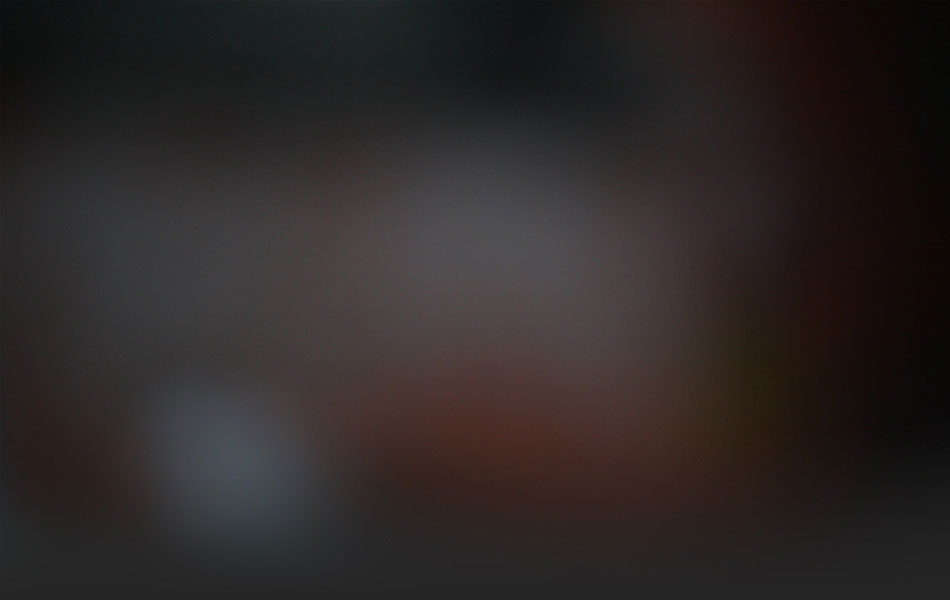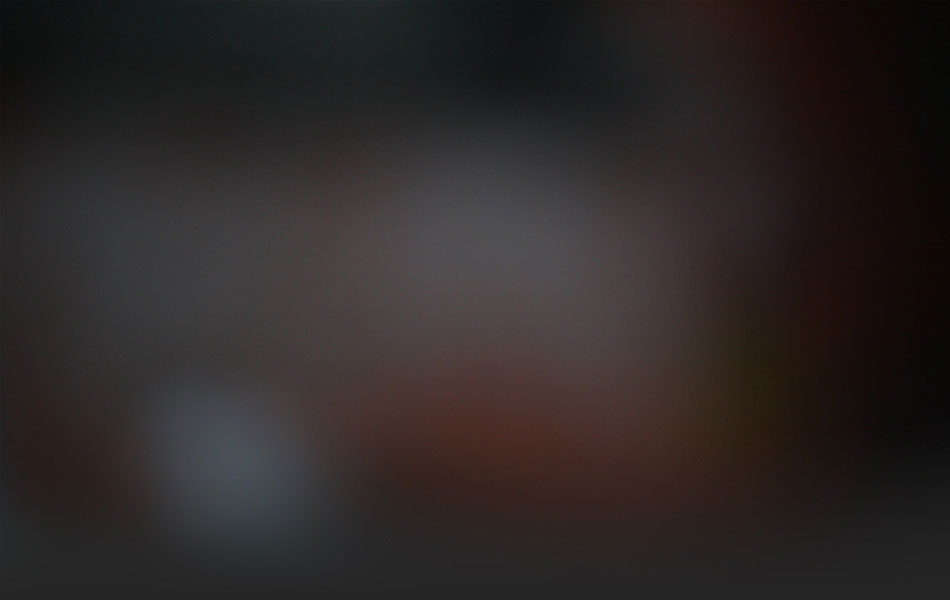Donnerstag, der 16. Juli 1914
* Russische Warnung *
Kanzler Bethmann Hollweg telegraphiert dem Staatssekretär für Elsass-Lothringen, Siegfried von Roedern (1870–1954), er habe in Berlin veranlasst, „dass jede Presspolemik gegen Frankreich für die nächsten Wochen nach Möglichkeit abgestoppt wird.“ Was er konkret unternommen hat, wird nicht erwähnt. Er bittet Roedern aber, in Strassburg das Gleiche zu tun und außerdem jede geplante administrative Maßnahme zu verschieben, die in Frankreich „agitatorisch aufgegriffen“ werden könnte. Denn man wolle es dem „mit allerlei Sorgen belastete[n] Frankreich“ erleichtern, neutral zu bleiben oder gar in St. Petersburg zum Frieden zu mahnen.
Insgesamt spielt Frankreich jedoch in der deutschen Presse zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine Rolle, so dass es für Bethmann Hollweg wohl nicht viel „abzustoppen“ gab. Wenn neben Serbien weitere Feindbilder bemüht werden, dann sind das Russland oder der politische Gegner im eigenen Land.
Roedern erwidert, er habe die Straßburger Post verständigt, dass in nächster Zeit keine Polemik getrieben werden solle, andere Zeitungen bedürften der Mahnung nicht.
Während die deutsche Regierung so allerorten auf die öffentliche Meinung einzuwirken versucht und sich diplomatisch um die Regierungen in England, Italien, Rumänien und Bulgarien bemüht, gibt es keinerlei Initiativen in Richtung Russland. Es sind nicht einmal Überlegungen bezüglich einer Strategie gegenüber dem Zarenreich bekannt. Man weist lediglich den Nachrichtendienst an, die Vorgänge dort zu beobachten.
Dabei ist keineswegs klar, wer in St. Petersburg die Fäden in der Hand hält. Theoretisch ist es der Zar. Doch Nikolaus II. (1868–1918) ist im Grunde ebenso wenig berechenbar wie der deutsche Kaiser. Ob und wie sehr er sich in die Politik einmischt und wem er sein Ohr leiht, ist starken Schwankungen unterworfen, die oft mehr emotionaler Natur sind, als dass sie mit politischen Konzepten zu tun haben. Der Ministerrat aber wird seit Februar von einem schwachen, alten Mann namens Ivan Goremykin (1839–1917) geführt, während Innenminister, Agrarminister und Kriegsminister glühende Nationalisten sind. Außenminister Sasonow schließlich gilt als moderat und besonnen, ist aber nicht desto trotz ein Machtpolitiker. Bei einer solchen Konstellation erscheint es hanebüchen, darauf zu vertrauen, dass der Zar keine Königsmörder unterstützen wird. Geht man allerdings davon aus, dass die deutsche Regierung gar nicht darauf vertraut, sondern „prüfen“ will, ob die russische Kriegspartei kampfbereit und durchsetzungsfähig ist, dann macht die diplomatische Zurückhaltung Sinn.
Das russische Außenministerium wird jedoch selbst aktiv und lässt in Wien mitteilen, dass man keinen Anschlag auf die serbische Integrität und Unabhängigkeit dulden werde. Allerdings übermittelt es diese Warnung über den italienischen Botschafter, um der Aktion die diplomatische Schärfe zu nehmen.
Die allgemeine Stimmung in Russland ist jedoch extrem österreichfeindlich, wie der deutsche Botschafter Friedrich von Pourtalès nach Hause mitteilt. Seiner Meinung nach schlage die Erbitterung gegen die Donaumonarchie immer mehr in grenzenlose Verachtung um. London-Botschafter Lichnowsky bestätigt, auch sein russischer Cousin Benckendorff spreche von einer heftigen antiösterreichischen Stimmung in seiner Heimat. Allerdings seien laut Benckendorff, weder der Zar noch eine andere maßgebliche Persönlichkeit antideutsch gesonnen.
Den deutschen Außenamts-Chef Jagow beschäftigen derweil vor allem Gerüchte über das britisch-russische Marineabkommen, das kurz vor dem Abschluss stehen soll. Allerdings hält er Lichnowsky nicht für den richtigen Mann, sich damit zu befassen, sondern beauftragt den bewährten Mittler Albert Ballin, seine Beziehungen spielen zu lassen, um das Abkommen vielleicht noch zum Scheitern zu bringen. Er entschuldigt sich, Ballin in der Badekur zu stören, meint aber, man dürfe nichts unversucht lassen. Der Reeder nimmt die Sache so ernst, dass er sich nicht nur ans Telefon hängt, sondern sofort seinen Urlaub abbricht und nach England reist.
Im ungarischen Reichstag erklärt Ministerpräsident Tisza, dass der Schritt gegen Serbien nicht notwendigerweise zu kriegerischen Verwicklungen führen müsse. Seine Erklärung wird in fast allen Zeitungen abgedruckt, doch nur wenige, wie etwa die Frankfurter Zeitung, finden sie beunruhigend. Das verwundert, denn bisher hat die deutsche Presse kriegerische Verwicklungen eigentlich so gut wie ausgeschlossen. Ausländische Pressestimmen aus Russland, England und Italien, die auch in deutschen Zeitungen nachgedruckt werden, sind dagegen viel besorgter.
Der Vorwärts allerdings stellt klar, dass man eigentlich noch gar nichts über den österreichischen Schritt wisse, da sich die k.u.k.-Regierung noch in keiner Weise dazu geäußert habe. Alle bisherige Hetze und Aufregung sei eine Sache der Presse. Andererseits bestehe auch kein Grund zur Entwarnung. Die Pläne könnten von einer schlichten Aufforderung, bei den Untersuchungen zu helfen, bis zum bedrohlichen Ultimatum reichen. Irgendwelche Bürgschaften gegen die großserbische Agitation seien schwer vorstellbar. Entweder wären es Eingriffe in die Souveränität Serbiens oder sie blieben wirkungslos und wären damit nur Wasser auf die Mühlen der großserbischen Hetzer. Die österreichische Kriegspartei wünsche mit Sicherheit einen Vernichtungsschlag, urteilt das Sozialistenblatt. Es bleibe nur zu hoffen, dass sich die Regierung auf eine weniger riskante, diplomatische Aktion beschränke.
Aber die Entscheidung scheint in weite Ferne zu rücken. Die Kölnische Zeitung behauptet, die österreichischen Untersuchungen zum Attentat würden noch mindestens zwei Wochen dauern.