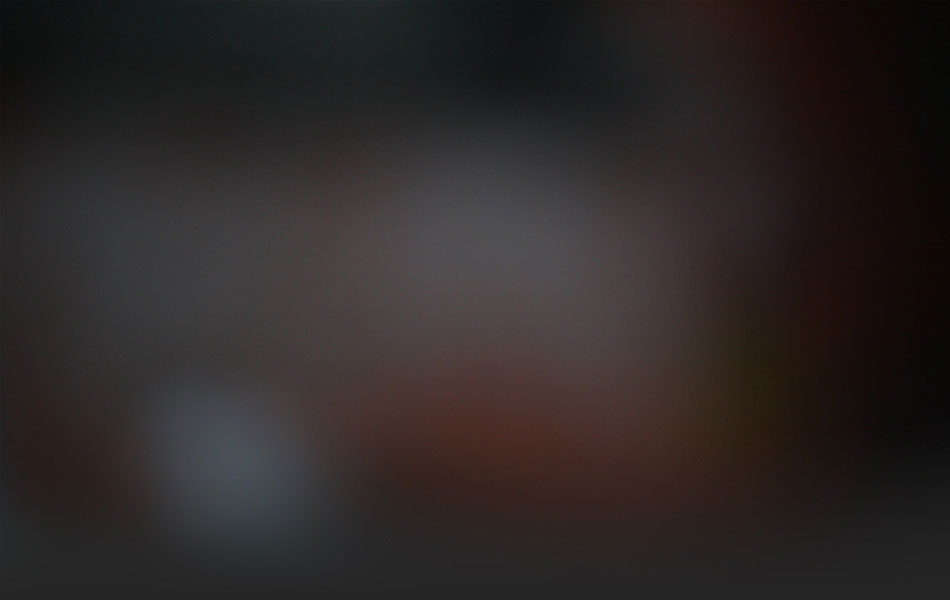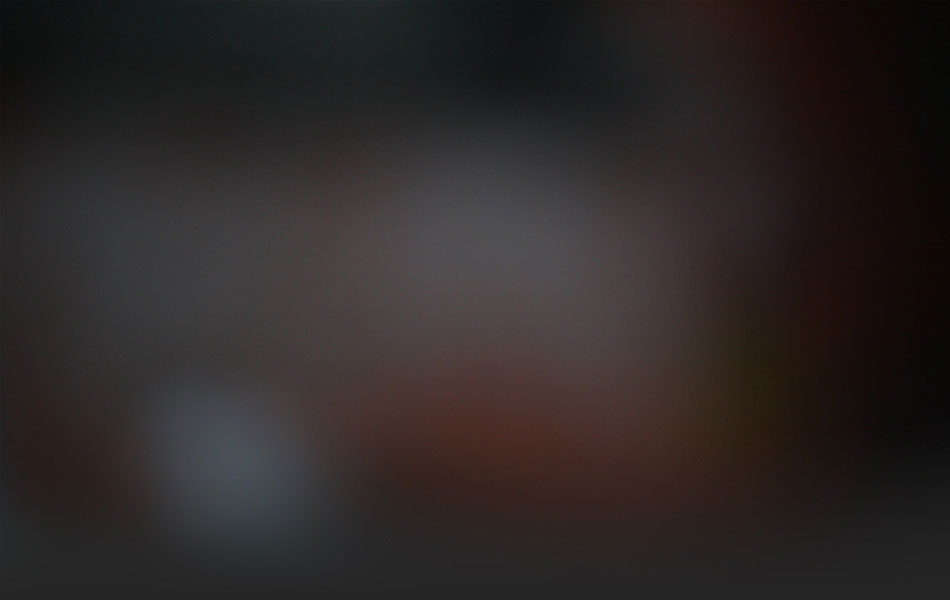Sonntag, der 19. Juli 1914
* Strategiediskussionen in Österreich * Preußischer Militarismus
K.u.k.-Außenminister Berchtold führt sein Sonntagsbesuch zu Kaiser Franz Joseph nach Bad Ischl, offiziell wegen „laufender Geschäfte“. Der Monarch meint, es gäbe kein Zurück mehr. Eine schwächliche Haltung könne das Land gegenüber Deutschland diskreditieren.
Aber ein „Zurück“ ist auch nicht geplant. Der in Wien tagende Ministerrat beschließt die endgültige Fassung des Ultimatums. Streit gibt es nur über die Behandlung Serbiens. Der ungarische Ministerpräsident Tisza möchte von seinen Kollegen die Zusage, dass es keine Annexion durch Österreich-Ungarn geben wird. Sie gestehen ihm zu, dass man sofort bei Kriegsbeginn allen Mächten mitteilen werde, dass es kein territoriales Interesse gäbe. Die konkreten Pläne aber sehen so aus: Österreich nimmt nichts für sich – außer eventuell ein paar „strategische Brückenköpfe“ wie Schabatz (Šabac) – aber Serbien wird zugunsten von Griechenland, Albanien, Bulgarien und vielleicht auch Rumänien verkleinert. Für den Fall allerdings, dass sich diese Mächte gegen Österreich-Ungarn stellen, beharren die anderen Minister gegenüber Tisza darauf, doch Teile Serbiens annektieren zu dürfen. Nach der Sitzung sagt Generalstabschef Conrad von Hötzendorf zu Kriegsminister Krobatin: „Vor dem Balkankrieg haben die Mächte auch vom status quo gesprochen – nach dem Krieg hat sich niemand mehr darum gekümmert.“
Aus Norwegen meldet sich Kaiser Wilhelm II. bei seiner Regierung. Er möchte, dass die Direktoren der großen Schiffslinien HAPAG und Norddeutscher Lloyd gewarnt werden und die deutsche Kriegsflotte, die sich seit dem 14. Juli zu Übungen am Skagerrak befindet, zusammengehalten wird. Dem ersten Wunsch kommt die deutsche Regierung nach, was den zweiten betrifft, lässt sie beim Admiralsstab anfragen, wie man verhindern könne, dass der Kaiser nach einer Ablehnung des Ultimatums vorzeitig verdächtige Bewegungen der Flotte befiehlt. Denn auch die britische Marine ist zu Manövern im Ärmelkanal ausgelaufen. Diese sollen bis zum 27. Juli dauern und die deutsche Regierung möchte unbedingt erreichen, dass die britischen Schiffe danach planmäßig in ihre verschiedenen Heimathäfen zurückkehren, anstatt wegen drohender Kriegsgefahr zusammenzubleiben. Der Admiralsstab geht jedoch auf die Frage nicht ein, sondern dringt seinerseits darauf, dass die eigene Flotte mindestens sechs Tage vor einem möglichen deutsch-englischen Kriegsausbruch nach Hause gerufen wird.
Währenddessen verbringen in der englischen Grafschaft Wiltshire der deutsche Botschafter Lichnowsky und sein russischer Cousin Benckendorff das Wochenende auf dem Landsitz des ehemaligen britischen Außenministers Lord Henry Lansdowne (1845–1927). Benckendorff schreibt seinem Chef Sasonow hinterher „Streng persönlich!“, sein sonst so ruhiger und abgeklärter Verwandter sei extrem beunruhigt gewesen und habe ihn ununterbrochen wegen des österreichischen Schrittes bestürmt. Lichnowsky befürchtet „Tölpeleien“, die für Belgrad unannehmbar sind. Deshalb drängt er den russischen Vetter, dafür zu sorgen, dass St. Petersburg etwas unternimmt, bevor der österreichische Schritt erfolgt. Ihm schwebt z. B. vor, dass der Zar an Kaiser Franz Joseph schreibt und seine Dienste als Vermittler anbietet. Wenn Österreich den Krieg wolle, sagt er zu Benckendorff, sei zwar nichts zu machen, aber man müsse verhindern, dass die Donaumonarchie aus Ungeschicklichkeit in einen Kampf hineingerate. Benckendorff hält die Befürchtungen seines Cousins für übertrieben und seine Vorschläge für nicht durchführbar. Aber er schreibt Sasonow, „je ostentativer, handgreiflicher und realer“ Russland auf Vermeidung eines Krieges hinarbeite, desto besser.
In der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung erscheint Jagows Artikel. Ansonsten schlägt sich die deutsche Presse mit Gerüchten herum. Im Großen und Ganzen ist die Stimmung recht entspannt, auch wenn die Kreuzzeitung meint, ihre Leserschaft mit den kriegerisch-patriotischen Versen eines gewissen Paul von Roëll (1854–1922) beglücken zu müssen.
„Gewiss mein Freund, groß sind die Zeiten nicht.
Das deutsche Schwert ruht lässig in der Scheide;
Ein jeder tut einfach nur seine Pflicht;
Es liegt wie Dämm’rung auf der deutschen Heide. –
Doch denk der sechz’ger Jahre –
Herzbeschwert - keimlos und faul erschien der deutsche Samen!
Da schlug bei Düppel los das Preußenschwert –
Wilhelm und Moltke, Roon und Bismarck kamen!
Mein lieber Freund, du bist ein Pessimist:
Ich leugne dies ‚Geschehnis tiefen Falles’.
Ein zweiter Wilhelm unser Kriegsherr ist –
Sein Heerruf lautet: Deutschland über alles!
…
Mein lieber Freund, wenn du auch trübe schaust –
Lass die Feinde dicht und dichter scharen!
Ich glaub’ an unsres Kaisers Kaiserfaust –
Die wird, wenn’s Not tut, schon dazwischenfahren!
Der Friede war vielleicht für uns zu lang;
Zwar blüht die Kunst, doch fehlen Charaktere.
Und doch, mein Preußenherz ist d’rum nicht bang:
Der Kaiser wacht ja über Deutschlands Ehre!
Mein lieber Freund, du bist ein Patriot.
Doch leug’n ich dein ‚Geschehnis tiefen Falles’ –
Und wenn uns hundertfach Gefahr umdroht.
Der Kaiser hoch! Und Deutschland über alles!“
Das Ganze ist aber kein aktuelles Kriegsgetrommel, sondern die Erwiderung auf ein Gedicht, das eine Woche zuvor erschienen ist. Der im Gedicht angesprochene „liebe Freund“ ist ein dichtender Pfarrer namens Karl Ernst Knodt (1856–1917). Dieser vermisst jedoch keine Kriegstaten. Stattdessen hat er in dem beanstandeten Gedicht prophezeit, Deutschland stehe vor „eines tiefen Falles Geschehnis“, da ihm Genies wie Luther, Goethe, Bismarck und Beethoven fehlen. „Klein ward die Zeit. Kein Stern der Größe stellt sich ins Licht der Gegenwart“, lautete seine Klage.
Während der fast vergessene Knodt immerhin mit Literaten wie Hermann Hesse, Agnes Miegel und Wilhelm Raabe verkehrte und als „Dichter der Sehnsucht“ galt, trug der völlig vergessene Roëll den Beinamen „Hohenzollerndichter“. Nach einer Kriegsverwundung 1870 hatte er die Feder zu seiner Waffe erkoren und erfreute seine Leserschaft mit Editionen wie Hohenzollern-Sang oder Schwert und Rose. Solche Ergüsse waren jedoch gang und gäbe im wilhelminischen Kaiserreich. Jenseits der Macht des Militärs, das keinerlei demokratischer Kontrolle unterworfen war, jenseits der Agitation der Alldeutschen, die leidenschaftlich eine kriegerische Politik forderten, gab es ein Hineinwirken des Militärischen in den Alltag und einen nostalgischen Kriegs-, Preußen- und Vaterlandskult, die die wilhelminische Gesellschaft zutiefst prägten. In keinem anderen Land wurde so viel und so stolz Uniform getragen und nirgendwo wurde von den Zivilisten so viel Respekt vor dem „Ehrenkleid des Kaisers“ eingefordert. In rund 22.000 Kriegervereinen pflegten fast 3 Millionen Mitglieder das Andenken an die Einheitskriege und sorgten allerorten dafür, dass Kaisergeburtstag und Sedan-Tag als Volksfest mit Paraden, Hurra-Orgien und patriotischen Reden begangen wurden. Das Militär galt gemeinhin als „Schule der Nation“, und Schulunterricht wurde oft genug mit militärischer Härte exerziert. Spätere Offiziere traten meist schon mit 10 oder 12 Jahren in Kadettenanstalten ein, in denen ein besonders unerbittlicher Drill herrschte und alles Preußisch-Militärische pseudoreligiös überhöht wurde, jedes andere Denken aber verteufelt. Unteroffiziere wurden nach ihrer zwölfjährigen Dienstzeit in der Regel in die Verwaltung versetzt und sorgten dort für die entsprechende Kasernenhof-Atmosphäre. Wer Geld und Abitur hatte, konnte dagegen seinen Wehrdienst als „Einjährig-Freiwilliger“ ableisten. Diese Ausbildung taugte militärisch nicht viel, machte den Betreffenden aber zeitlebens zum Reserveoffizier. So erhielten etwa künftige Wirtschaftsführer, Professoren, Richter und andere Spitzenbeamte einen militärischen Titel und eine Uniform. Sie wurden angehalten, beides möglichst oft zu verwenden, auf „Nichtgediente“ herabzusehen und sich damit als Teil der deutschen Wehrhaftigkeit und Garant der deutschen Stärke zu sehen. Die Vorstellung der Vaterlandsliebe war gemeinhin so eng mit dem Militär verschmolzen, dass alle „puren Zivilisten“ unter einem enormen Rechtfertigungsdruck standen. Das führte dazu, dass sie oft besonders eifrig darauf aus waren, ihren Patriotismus unter Beweis zu stellen. Auch in Kunst, Kultur und Geisteswissenschaften wurden Preußen, sein Militär und die „Vaterlandsliebe“ in einem Maß glorifiziert, das man sich heute kaum noch ausmalen kann. Denn die meisten dieser peinlich-pathetischen Machwerke – wie etwa die Verse Roëlls – fielen schlicht dem Vergessen anheim.
Nicht vergessen ist dagegen, dass im Jahr 1906 ein arbeitsloser Schuster die Stadtkasse von Köpenick requirieren und den Bürgermeister verhaften lassen konnte, nur weil er eine Uniform vom Flohmarkt trug und den üblichen Befehlston beherrschte. Zwar konnte ein Großteil der Deutschen über diesen Streich lachen, und auch die Lehre daraus wurde sehr wohl gesehen. So schrieb etwa die Vossische Zeitung „Der Sieg des militärischen Kadavergehorsams über die gesunde Vernunft, über die Staatsordnung, über die Persönlichkeit des einzelnen, das ist es, was sich gestern in der Köpenicker Komödie in grotesk-entsetzlicher Weise offenbart hat.“ Doch eine jahrhundertelange Prägung verliert sich nicht in wenigen Jahren. Auch 1914 war die teils bereitwillige, zunehmend aber auch zähneknirschende Unterordnung der Bevölkerung unter den militärischen Geist noch enorm hoch. Der Literat Heinrich Mann (1871–1950) charakterisierte seine Landsleute in seinem Aufsatz Kaiserreich und Republik wegen dieser Mischung aus Gehorsam und nationaler Überheblichkeit als ein „Herrenvolk von Untertanen“.