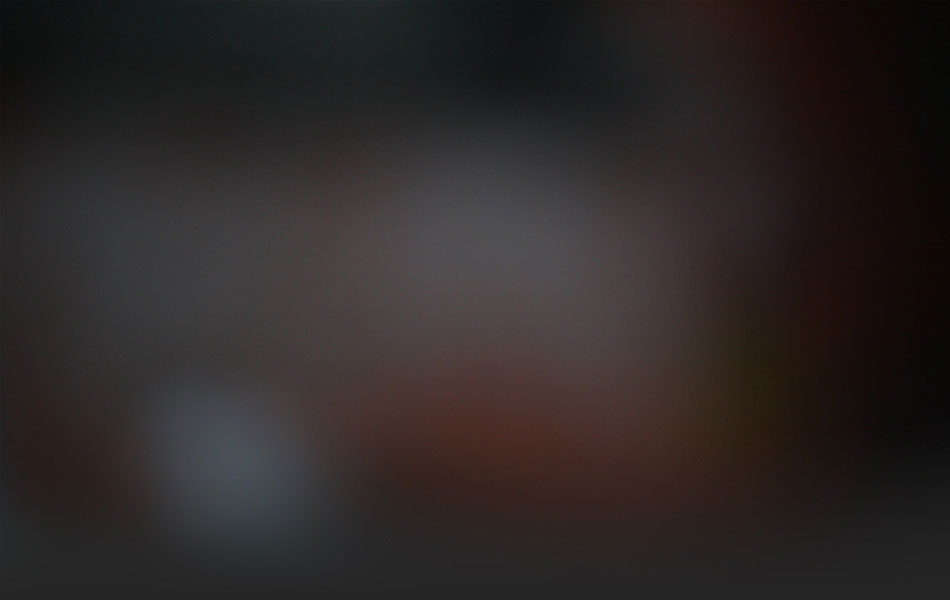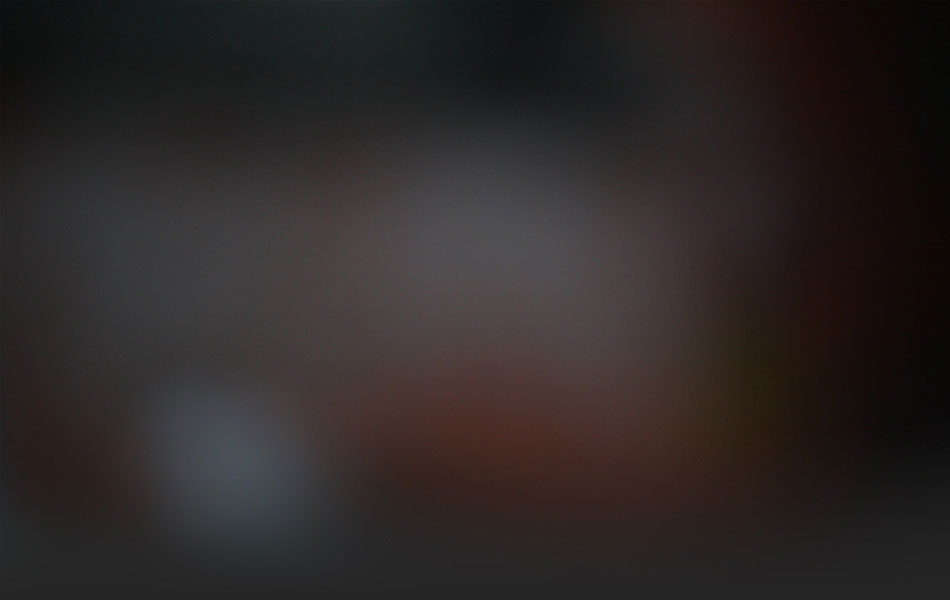Mittwoch, der 8. Juli 1914
* Deutsches Drängen * Presse-Spekulationen über einen „Schritt“ * Die deutsche Militärpolitik *
Der österreichische Botschafter Szögyény-Marich meldet aus Berlin, dass Zimmermann und „verschiedene maßgebende Persönlichkeiten des Auswärtigen Amtes“ mit Ungeduld einem energischen Auftreten gegen Serbien entgegensehen. Außerdem verrät er, der deutsche Botschafter Tschirschky habe wegen seiner anfänglichen Lauheit einen Verweis bekommen.
Falls Tschirschky wirklich jemals lau war, kann davon inzwischen keine Rede mehr sein. Möglicherweise sogar ohne direkte Anweisung aus Berlin erklärt er k.u.k.-Außenminister Berchtold, dass Deutschland eine ernste Aktion gegen Serbien erwarte und ein Zögern nicht verstünde. Berchtold braucht diese Mahnung eigentlich nicht. Er ist für einen Krieg, vor allem aber sitzen in seinem Ministerium lauter „Falken“, wie etwa Hoyos oder Johann von Forgách (1870–1935), den seit seiner Zeit als Botschafter in Belgrad eine persönliche Feindschaft mit diversen serbischen und russischen Diplomaten verbindet. Berchtold leitet das deutsche Drängen auch prompt an Ministerpräsident Tisza weiter, der wieder nach Budapest gereist ist. „Vorstehende Ausführungen Tschirschkys scheinen mir von solcher Tragweite, dass sie eventuell auch von Einfluss auf Deine Schlussfassungen sein könnten, daher ich Dir ungesäumt davon Mitteilung machen wollte.“
Berchtolds Aktion verfehlt jedoch die gewünschte Wirkung. Tisza schreibt stattdessen dem Kaiser, der in Ischl weilt: „Ein derartiger Angriff auf Serbien würde nach jeder menschlichen Voraussicht die Intervention Russlands und somit den Weltkrieg heraufbeschwören.“ Tatenlos gegen Serbien dürfe man aber angesichts der Provokationen nicht bleiben. Der ungarische Ministerpräsident empfiehlt, „eine in gemessenem, aber nicht drohendem Tone gehaltene Note an Serbien zu richten.“ Würden die „gerechten Forderungen“ zurückgewiesen, sei er mit Krieg als Konsequenz einverstanden.
Im ungarischen Parlament erklärt Tisza, über den Schritt gegen Serbien könne er noch nichts sagen, aber man werde sowohl die Interessen am Friedenserhalt als auch die Lebensinteressen und das Prestige Österreich-Ungarns berücksichtigen. Der russische und der französische Botschafter in Wien melden nach Hause, dass man wohl eher keinen aggressiven Schritt gegen Serbien plane.
In London jedoch äußert Außenminister Grey gegenüber dem russischen Botschafter Alexander von Benckendorff (1849–1917) die Befürchtung, die aufgeheizte, antiserbische Meinung in Österreich könne die dortige Regierung zu einem aggressiven Schritt treiben. Auch Deutschland macht ihm Sorgen, da ihm klar ist, dass es dort Kreise gibt, die einen Krieg gegen Russland wünschen. Benckendorff allerdings, der mütterlicherseits ein direkter Cousin des deutschen Botschafters Lichnowsky ist, hält die deutsche Reaktion auf das Attentat für besonnen. Seiner Überzeugung nach würden weder der Kaiser noch die Regierung Präventivkriegspläne hegen. Außerdem äußert er die Hoffnung, dass Deutschland mäßigend auf Wien einwirken werde. Grey jedoch bleibt skeptisch.
Auch in der deutschen Presse gibt es Spekulationen über einen „Schritt“. Die Frankfurter Zeitung meldet, dass die serbische Regierung höflich aufgefordert werden soll, die Untersuchungen über das Attentat weiterzuverfolgen und Maßnahmen gegen die großserbische Propaganda zu unternehmen. Konkret solle sie wohl eine Regierungserklärung abgeben und Kampforganisationen auflösen. Die Aktion fände noch diese Woche statt.
Einige Zeitungen berichten auch, dass Russland seine Manöver bis zum 1. Oktober verlängert habe. Die katholische Germania titelt „Rückendeckung der serbischen Verschwörer“ und mutmaßt, dass Russland von Serbien im Vorfeld über das Attentat auf Franz Ferdinand informiert worden sei. Nun mache sich das Zarenreich bereit, einen österreichischen Schritt gegen Serbien zu verhindern. Die anderen Zeitungen nehmen diese Spekulationen jedoch nicht auf und auch die Germania lässt sie später wieder fallen.
Fern von jeder akuten Kriegspanik ist auch Minister Falkenhayn. Er verfasst einen Brief an Bethmann Hollweg und informiert den Kanzler über eine Unterredung, die er am 2. Juli mit dem Kaiser gehabt hat. Dabei ging es aber keineswegs um das Attentat und seine Folgen, sondern um einen alten Zwist, den das deutsche Kriegsministerium und der Generalstab miteinander haben.
Die große Heeresvorlage von 1913, in der Deutschland seine „letzten Kräfte“ mobilisierte, ist nämlich alles andere als vollständig umgesetzt. Es fehlt an Offizieren. Der Generalstab, in Panik vor einer baldigen russisch-französischen Überlegenheit, würde auch Anwärter aus einfacheren Bevölkerungskreisen akzeptieren. Dagegen jedoch sperren sich das Kriegsministerium und die alten Eliten mit Händen und Füßen. Sie fürchten, dass vulgäre, demokratische oder gar sozialistische Gedanken in die Armee getragen werden könnten. Deshalb bestehen sie darauf, dass Offiziere aus dem Adel oder – schon ein Zugeständnis – aus dem gehobenen Bürgertum stammen müssen. Schließlich soll die Armee ja nicht nur für den Krieg nach außen, sondern im Bedarfsfall auch zur Bekämpfung „feindlicher Elemente“ im Inneren einsetzbar sein.
Als Kompromiss hat Falkenhayn nun mit dem Kaiser eine langsame Aufstockung innerhalb der nächsten zehn Jahre vereinbart. Den Bedenken des Generalstabs hält er entgegen, dass man das russische Heer sowieso nie quantitativ überflügeln könne. Also müsse man darauf achten, dass die Qualität gewahrt bleibe.
Zehnjahresplan klingt nicht gerade nach einer Nation, die einen Krieg gegen zwei bis drei Großmächte riskiert. Aber schließlich glaubt der Kriegsminister auch nicht, dass Österreich ernst machen wird. Noch am gleichen Abend tritt er eine kurze Dienstreise an, um danach mit Frau Ida und den Kindern Fritz und Erika (der späteren Frau des Widerstandskämpfers Henning von Tresckow) wie jeden Sommer Urlaub auf Juist zu machen.